Immer dann, wenn du über „Die Zukunft“ schreibst, möchte ich, dass du dich an diesen Text erinnerst. Ein Text für alle, die professionell in den Medien arbeiten, und das Wort Zukunft nutzen.
Im folgenden Text versuche ich zu erklären, warum wir bisher falsch über Zukunft gesprochen haben, warum eine genauere Sprache heute wichtiger denn je ist, und wie wir es richtig machen.
The Verge, eines der bedeutendsten amerikanischen Tech-Publikationen, und Vox Media, Eigentümer von The Verge, haben gemeinsam eine Umfrage herausgebracht. Darin versuchen sie dem Gefühl auf den Grund zu gehen, dass durch die sich beschleunigende Veränderung von Social Media (X anybody?) imminenter wurde. 2.000 US-amerikanische Erwachsene bestätigen darin: Mehr und mehr Menschen misstrauen großen Plattformen. Privatere digitale Rückzugsräume werden bevorzugt.
So weit so erwartbar. Wer sich schon länger mit Social Media beschäftigt, erhält hier erneut die Bestätigung dafür, was wir eigentlich schon irgendwie wussten. Den Artikel könnt ihr hier (→) nachlesen.
Den Artikel erwähne ich weniger aufgrund des Themas. Meine Kritik wendet sich an die Art, wie die Autoren der Umfrage die Ergebnisse zusammenfassen:
- Im Titel: „Die Zukunft des Internets wird wahrscheinlich in kleineren Gemeinschaften liegen, mit einem Schwerpunkt auf kuratierten Erlebnissen“ (The future of the internet is likely smaller communities, with a focus on curated experiences)
- In der Mitte: Die Zukunft von Communities ist persönlich, zweckgebunden und basiert auf Trust. (The future of community is personal, intentional, and built on trust.)
- Im letzten Punkt ihrer Liste der Ergebnisse: „Kleinere, zielgerichtete Gemeinschaften sind die Zukunft.“ (Smaller, purpose-driven communities are the future.)
Ich spiele dann hier mal die Zukunftspolizei, und stelle einen digitalen Strafzettel aus: Zwei Punkte auf dem Strafkonto der Time Regulatory Authority (Anspielung an die TVA aus dem Marvel Cinematic Universe). Denn so sollten Journalisten nicht über die Zukunft sprechen. Während sie sich in der Überschrift noch ein bisschen zurückgehalten haben und das Wort „wahrscheinlich“ (likely) verwendet haben, lassen sie es später einfach weg.
Und wo ist das Problem?
Wenn ihr euch jetzt fragt, wo hier das Problem ist, ist das verständlich. Denn im Grunde schreiben sie so wie alle schreiben. Kein Fehler erkennbar. Zumal es sich so deutlich leichter verkaufen lässt. Das macht die Verwendung nicht besser, und ist als Teil der Aufmerksamkeitsökonomie system-typisch und äußerst problematisch.
→ Den ersten Punkt gibt es dafür aus zu wenigen Datenpunkten einen Trend abzuleiten.
→ Den zweiten Punkt für die Nutzung des Begriffs „Die Zukunft.“
The Verge macht es sich hier zu einfach. Auch wenn es schon länger den Trend des „Dark Social“ gibt, ist das noch lange kein eindeutiger Beweis dafür, dass das auch so bleiben wird, oder dass sich das noch verstärkt. Es lässt zudem völlig die Frage außer Acht, ob das überhaupt so sein sollte.
Die Verwendung des Begriffs „Die Zukunft“ ist schlicht falsch. Zukunftsforscher sprechen von Zukünften, und zwar aus gutem Grund. Die eine Zukunft gibt es nicht. Physiker würden sogar so weit gehen zu sagen, dass es noch nicht mal die Zeit gibt. Sie ist keine messbare Kraft in der Natur, sie ist nichts, was sich wie Energie oder Materie messen ließe. Physiker nutzen die Zeit als Durchlaufvariable. Zeit ist eine mathematisch notwendige Erfindung, um einen Prozess zu beschreiben. Was mit der Uhr gemessen wird, ist nicht die Zeit, sondern ein Rhythmus, auf den wir uns als Menschheit geeinigt haben (und der aufgrund unserer Bewegung um die Sonne sinnvoll ist). Dahinter steckt keine Kraft, außer die der Mechanik im Falle einer mechanischen Uhr selbst. Eine Uhr ist kein Sensor für ein natürliches Phänomen.
Auch wenn sich gewisse Trends fortführen lassen, oder bestimmte Modelle heute Vorhersagen für kurzfristige Entwicklungen zulassen, ist die Vorhersage von komplexen Sachverhalten unmöglich.
Dennoch gibt es einen vorstellbaren Möglichkeitsraum, der zeitlich vor uns liegt. Er ist ein Raum voller Ideen von etwas, was irgendwie denkbar ist. Diese Denkbaren Szenarien nennen wir Zukünfte.
Und doch sprechen so viele von Zukunft. Warum?
Wenn ich interessengetrieben kommuniziere, zum Beispiel weil ich ein Politiker bin, oder weil ich mein Produkt verkaufen möchte, dann versuche ich die vorstellbaren Möglichkeiten auf jene einzuschränken, die für mich nützlich sind.
So kommt es, dass jemand, der ein Blockchain-Startup hat, ganz selbstverständlich auf LinkedIn schreibt: Blockchain ist die Zukunft. Damit werden nicht nur andere Möglichkeiten ignoriert. Durch die Art, wie es gesagt wird, verhält sich der Sprecher zusätzlich übergriffig. Der meint nämlich ganz genau zu wissen, was die Zukunft aller Menschen ist, so als ob nicht jeder selbst darüber bestimmen sollte. So als habe man keine Wahl. Und wenn das nicht von den Rezipienten durchschaut wird, entsteht sogar die Angst etwas zu verpassen. Der Fachbegriff dafür ist Future Appropriation, Zukunftsaneignung. Eine unerlaubte Übergriffigkeit, die wirklich niemandem gut steht. Außer es bestehen unlautere Absichten.
Kommen wir zurück zur Umfrage von The Verge. Wenn die Autoren also hier davon sprechen, dass kleinere, geschlossene Communities die Zukunft seien, verhalten sie sich übergriffig, denn sie können gar nicht wissen, ob das wirklich so eintritt. Wenn sie wissen, dass das nicht so eintritt, sie aber eine Manipulation vornehmen wollen, ist das aus Sicht des Journalismus nicht zu vertreten.
Es gibt noch eine Möglichkeit, was The Verge gemeint haben könnte, in dem sie von Der Zukunft sprachen. Sie glauben, dass diese Zukunft gesellschaftlich wünschenswert sei. Dann sollte das aber auch entsprechend verständlich gemacht werden. Das kann man zum Beispiel durch so eine Formulierung erreichen: „Wir, die Autoren, glauben, dass der Trend zurück zu kleineren, kuratierten Communities ein positiver Trend ist, der wünschenswert ist.“ Damit bekennen sie sich zu einer Zukunft aus dem ganzen Strauß an Zukünften, ohne die anderen zu negieren, und den Möglichkeitsraum unredlich einzuengen.
Aber auch hier geht es noch ein bisschen besser. Noch besser ist es tatsächlich sich nicht nur zu eine der Zukünfte zu bekennen und dies sprachlich klarzumachen, sondern das auch zu begründen. Und so richtig gut wäre es, würden auch andere Zukünfte besprochen und abgewogen werden. So könnte sich nämlich der Leser ein besseres Bild davon machen.
Der Artikel macht aber dies: Er leitet eine Aussage über die Zukunft ab, die gar nicht in der Umfrage enthalten ist. Und er maßt uns seine Vorstellung von Zukunft an. Das geht so nicht.
Richtig könnte es der Artikel machen, in dem er so schreibt: „Aus der Umfrage ziehen wir Autoren den Schluss, dass der Trend zu immer kleineren, kuratierten Communities von Dauer sein könnte. Kleinere Communities haben mehrere Vorteile: Sie können leichter moderiert werden, es gibt weniger Reibung, da Menschen sich eher mit Gleichgesinnten austauschen, wodurch sie weniger toxisch sind. Dies scheint aktuell die naheliegendste Entwicklung zu sein, wobei nicht auszuschließen ist, dass sich das kurz-, oder mittelfristig ändert. Ob es sich dabei um die beste Entwicklung im Strauß der Zukünfte handelt, können wir aktuell nicht ausmachen. Das sich etwas am Netz und insbesondere am Social Web tun muss, steht für die Redaktion jedoch außer Frage.“
In der Tat ist die Frage, was eigentlich moralisch wünschenswert wäre, eine sehr gute Frage, zu der ich selbst Journalisten ermutigen möchte. Zunächst sollten sie aber die Ergebnisse von Umfragen und Studien sachlich einordnen. Ein Link zu den Daten der Studie fehlt zudem in unserem Beispiel.
Fazit
Wir haben gelernt: Wer professionell für die Öffentlichkeit schreibt, kann eigentlich nicht guten Gewissens über „Die Zukunft“ schreiben, ohne sich den Vorwurf gefallen zu lassen, übergriffig zu sein (Stichwort „Future Appropriation“) oder fahrlässig und schlampig. Zitate und Interviews, in denen jemand von Zukunft spricht, brauchen hier Nachfragen und Richtigstellungen und können so nicht einfach veröffentlicht werden. Um das leisten zu können, benötigen Medienmacher Future Literacy, Zukunftskompetenz, ohne die ein verantwortliches Publizieren nicht mehr denkbar ist. Zu stark ist die Lobby der übergriffigen Zukunftsapologeten auf die Geschicke der Demokratie. Das sehen wir gerade ganz besonders in der Art, wie Tech Trump zum Präsidenten gemacht hat. Der Sturm auf das Kapitol fand quasi via Social-Media-Manipulation statt.
Das betrifft im Speziellen Tech-Journalisten. Gerade im Tech-Bereich ist der Zukunfts-Jargon dominant. Aber gerade Tech-Journalisten müssen sich gegenüber Zukunfts-Blabla teflonisieren. Ansonsten sind sie einfach nur die ausgesourcte Marketingabteilung von Tech-Unternehmen.
Zum Abschluss soll diese Liste noch mal zusammenfassen, wie mit dem Begriff Zukunft in Texten umgegangen werden soll:
- Niemals sagen etwas sei „Die Zukunft“.
- Die Verkürzung auf „Die Zukunft“ in Titeln ist stets rauszustreichen, weil sie immer missbräuchlich ist.
- Zukunftsforscher sprechen von Zukünften, da es sich um Möglichkeitsräume handelt. Diese Vokabel sollten Medienmenschen so übernehmen.
- Den Begriff Zukunft möglichst selten verwenden, und eher von möglichen Entwicklungen sprechen.
- Trennen zwischen dem was zum Beispiel Studien oder Umfragen an Schlüsse für eine mögliche Entwicklung sagen können, und dem was aus Sicht der Autoren oder der Protagonisten wünschenswert wäre.
- Sprachlich klar machen, um was es sich im Bezug auf zukünftige Entwicklungen handelt: Sind es Fakten, Trends, Annahmen, Wünsche oder moralisch wünschenswerte Zukünfte?
- Der Zusammenhang zwischen den Aussagen einer Person und seiner Interessen transparent machen: Zum Beispiel bei jemandem, der davon profitiert, wenn der Blockchain-Hype weiter geht, weil er ein Blockchain-Startup hat und gleichzeitig behauptet Blockchain-Technologie wäre die Zukunft.
Bild: Photo by Aditya Chinchure on Unsplash
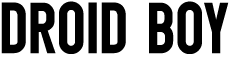




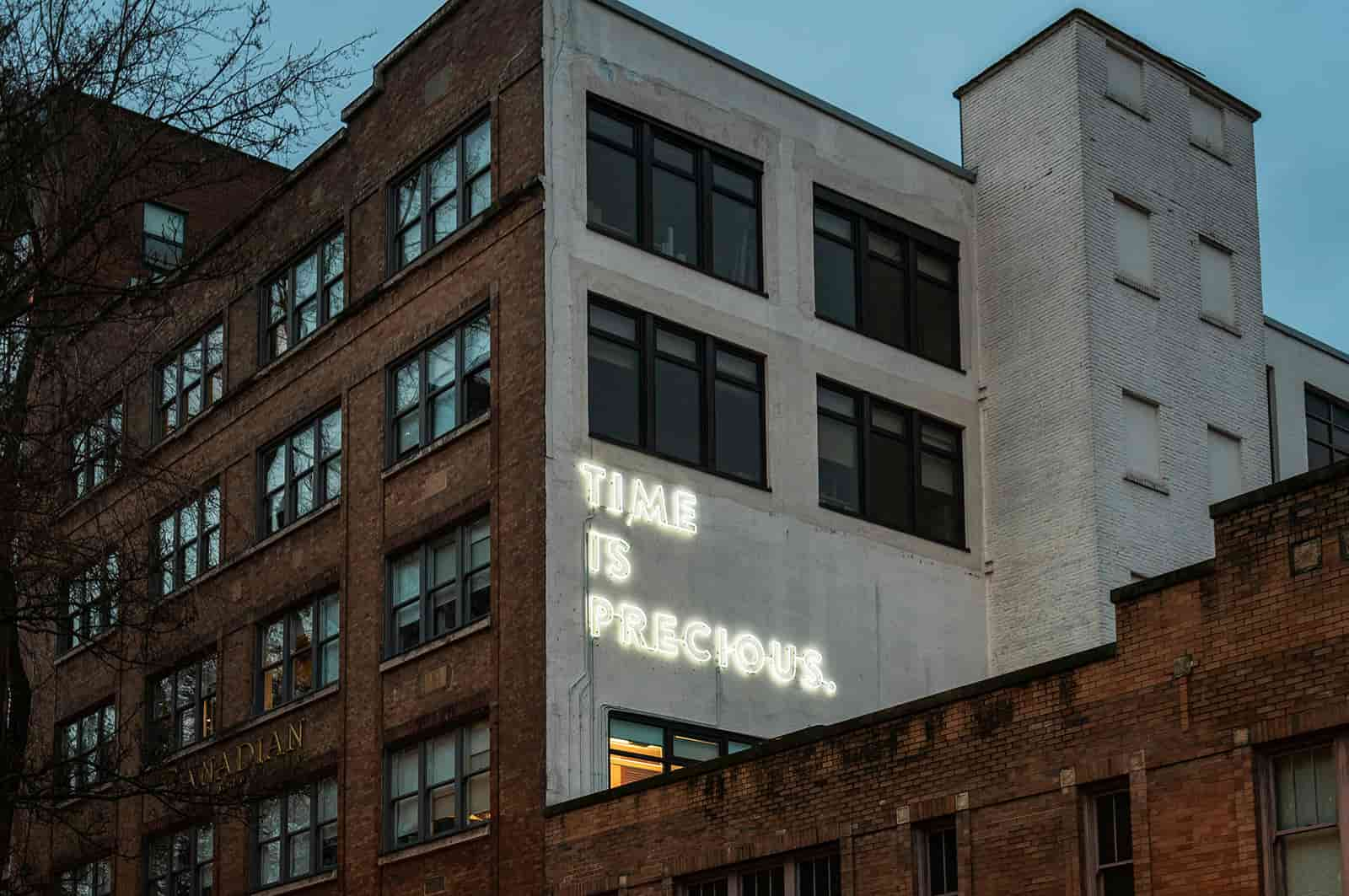
Schreibe einen Kommentar